Um das Dach der Welt zu erreichen, muss man sich mit seinen körperlichen, geistigen und biologischen Grenzen auseinandersetzen. Am 24. Mai 2025 erreichte Dr. Isabelle Frésard, Chefärztin, Abteilung Pneumologie – Verantwortliche der höhenmedizinischen Sprechstunde im Spital Martinach – den Gipfel des Everest (8 848 m). Ein ausserordentliches Abenteuer, das ihr wertvolle Informationen über die Hypoxie und das Leben ihrer Patientinnen und Patienten vermittelte.
Ein Aufstieg ohne Konzessionen
Während mehrerer Wochen stieg sie für eine schrittweise Angewöhnung ohne Sauerstoffzufuhr bis auf 7 000 m über die vereisten Hänge auf. Aber oberhalb dieser Schwelle wurde jede Handlung auch mit einer Sauerstoffflasche zu einer riesigen Anstrengung: einen Finger bewegen, einen Gurt anschnallen, über den nächsten Schritt entscheiden … alles brauchte viel mehr Zeit.
Auf der Höhe der Gipfelpyramide reduzierte sie den Sauerstoffzufluss, um die letzten Sauerstoffreserven zu schonen. Sofort spürte sie, wie die Sauerstoffsättigung abnahm: extreme Atemnot, erdrückende Müdigkeit, geistige Verwirrtheit. Diese Ausdrücke verwendet sie täglich, um die Symptome ihrer Patientinnen und Patienten zu beschreiben, die unter COPD, Lungenfibrose oder fortgeschrittener Ateminsuffizienz leiden. Jetzt erlebte sie das an ihrem eigenen Körper.
Vom Everest zur Sprechstunde: Erfahrung und individuelle Betreuung
Diese Erfahrung in extremer Höhe ist nicht nur eine persönliche sportliche Höchstleistung: Sie bildet eine direkte Verbindung zwischen Medizin und klinischer Praxis. Patientinnen und Patienten, die unter einer chronischen Hypoxie leiden, erleben diese Situation ständig in ihrem Alltag, und das in einer Höhe von weit unter 8 000 m. Sie müssen jeden Tag mit einer sehr schwachen Atmung leben: Jede Treppenstufe, jeder Spaziergang erfordert grosse Anstrengungen.

«Jeder Atemzug wurde zu einer Herausforderung. In dieser extremen Situation begriff ich, was es bedeutet, unter einem Sauerstoffmangel zu leiden, ohne direkt etwas dagegen tun zu können. Diese Erfahrung führte bei mir zu einer vertieften Reflexion über unsere Art, diejenigen Personen zu betreuen, die unter einer chronischen Hypoxie leiden.»
Die Besteigung des Everest motivierte mich dazu, unsere Versorgung zu überdenken:
- aktives Zuhören: die Anzeichen einer Ateminsuffizienz erkennen, bevor sie sich verschlimmern
- individuelle Betreuung: die Sauerstoffzufuhr optimieren, um eine Unter- oder Überdosierung zu vermeiden
- therapeutische Schulung: jede Patientin und jeden Patienten über die Bedeutung eines angepassten Fortschritts und die Einhaltung der eigenen Grenzen informieren
Ratschläge für Alpinistinnen/Alpinisten und Patientinnen/Patienten
Als Verantwortliche der höhenmedizinischen Sprechstunde erhielt ich durch diese Erfahrung auch neue Instrumente, um Alpinistinnen und Alpinisten sowie Personen, die Wanderungen im Hochgebirge unternehmen, zu beraten.
- Körperliche und geistige Vorbereitung: ein progressives Training, mit dem die Atemanstrengungen simuliert werden
- Stufenweiser Aufstieg: stufenweise aufsteigen, damit sich der Organismus an die Höhe gewöhnen kann
- Auf die Empfindungen achten: Müdigkeit, Kopfschmerzen, Benommenheit oder andere Anzeichen einer Höhenkrankheit beachten: Ein Abstieg oder ein Verzicht ist kein Misserfolg, sondern ein Zeichen von Weisheit.
Dieselben Grundsätze sind für Patientinnen und Patienten wichtig, die unter einer Hypoxie leiden: auf den eigenen Körper hören, seine Behandlung anpassen, das medizinische Team kontaktieren.


Die Demut des Atems
Der Everest erinnerte mich daran, dass keine Leistung die lebenswichtigen Signale ignorieren kann. Unabhängig davon, ob es sich um die Krankheit oder die Höhe handelt, zwingt uns der Atem zu einer Art von Demut und Bewusstsein: verlangsamen, seinen Körper beobachten, seinen Rhythmus und seine Grenzen einhalten.
Und diese Demut möchte ich weitergeben:
- an meine Patientinnen und Patienten, damit sie wieder Vertrauen und Autonomie gewinnen
- an die Personen, die sich im Hochgebirge aufhalten, damit sie ihren Traum in Sicherheit leben können
Denn der Atem ist der Faden, der die Lebensmomente miteinander verbindet.
Termine
Alle Werktage, ausser am Donnerstag.
Spital Martinach, Abteilung Pneumologie, 027 603 95 73, martigny.pneumologie@hopitalvs.ch

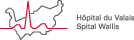













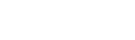




Kommentar hinzufügen