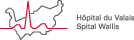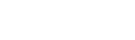Multiple Sklerose (MS) ist eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems, die das Gehirn und das Rückenmark schädigt. Obwohl die Ursachen dieser Erkrankung noch nicht in allen Details bekannt sind, haben die medizinischen Fortschritte erlaubt, die MS und ihre Folgen besser einzuschätzen. Oft nicht sichtbare neurologische Störungen können den Alltag der Patientinnen und Patienten stark beeinträchtigen. Erläuterungen von Dr. Sonia Kirchner, Neurologin im Spital Wallis, Standort Sitten.
Unsichtbare Symptome, die sich auf die Lebensqualität auswirken
Einer der schwierigsten Aspekte der MS besteht in der Vielfalt und Unsichtbarkeit gewisser Symptome. Eines der häufigsten Symptome ist besonders einschränkend. Es handelt sich um die Müdigkeit. Dabei geht es nicht einfach um einen vorübergehenden Energiemangel. Die Müdigkeit kann sich im Alltag so einschneidend auswirken, dass die Patientinnen und Patienten kein normales Leben mehr führen können. Die Müdigkeit in Zusammenhang mit der MS ist sehr schwer zu diagnostizieren. Sie ist nicht immer offensichtlich und es besteht die Gefahr, dass sie bei der Evaluation der Symptome vernachlässigt wird.
Häufig kommen auch andere Störungen wie Probleme mit der Motorik, kognitive Beschwerden (Konzentrations- und Aufmerksamkeitsschwächen) sowie Sehstörungen vor. Gewisse Symptome wie Probleme bei der Fortbewegung sind sichtbar. Hingegen sind kognitive Störungen, Empfindungsstörungen oder Schmerzen für andere unsichtbar, so dass die Erkrankung für das Umfeld nicht einfach zu erkennen ist und die Patientinnen und Patienten ihre sozialen Kontakte einschränken.
Multiple Sklerose: eine entzündliche Autoimmunerkrankung
MS ist eine entzündliche Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem greift irrtümlicherweise Zellen des zentralen Nervensystems an. Es handelt sich dabei insbesondere um das Myelin, eine Substanz, welche die Nervenfasern schützt. Dadurch kommt es zu einer Entzündung und zu Verletzungen, welche die Weiterleitung der Nervensignale beeinträchtigen. Diese Zerstörung der Nervenfunktion führt zu den unterschiedlichen Symptomen der MS.

Auch wenn die Ursache noch nicht vollständig bekannt ist, können mehrere Faktoren das Auftreten dieser Erkrankung begünstigen. Frauen sind stärker betroffen als Männer und bei Personen europäischen Ursprungs ist das Risiko einer Erkrankung ebenfalls höher. Umweltfaktoren wie niedriger Vitamin-D-Spiegel, Rauchen und virale Infektionen, insbesondere mit dem Epstein-Barr-Virus, gehören ebenfalls zu den Risikofaktoren, obwohl sie keine direkte Ursache der MS darstellen.
Diagnose manchmal schwierig
Die Diagnose der MS ist komplex. Sie beruht auf einer Kombination von klinischen, radiologischen und biologischen Kriterien. Mit der klinischen Untersuchung können die Symptome objektiv dargestellt werden, so dass ein erster Hinweis auf die Erkrankung besteht. Anschliessend gelangt die MRI (Magnetresonanztomographie) zum Einsatz, um die charakteristischen Verletzungen der MS im Gehirn und im Rückenmark nachzuweisen.
Manchmal zeigt eine MRI, die für andere Indikationen durchgeführt wird, auch ohne das Vorliegen von Symptomen gewisse Verletzungen auf. Dieser Zufallsbefund wird als «radiologisch isoliertes Syndrom» bezeichnet. In diesem Fall ist eine regelmässige Nachkontrolle notwendig, um gegebenenfalls das Auftreten neuer Verletzungen nachzuweisen. Manchmal wird auch eine Lumbalpunktion (Entnahme von Cerebrospinalflüssigkeit) durchgeführt, um nach Markern einer für die MS charakteristischen Entzündung zu suchen. Oft fürchten sich Patientinnen und Patienten jedoch vor diesem Verfahren.
Die Lumbalpunktion: kein furchteinflössendes Verfahren
Die Lumbalpunktion wird oft als ein schmerzhafter ärztlicher Eingriff wahrgenommen. In der Realität ist sie aber viel weniger invasiv und schmerzhaft, als viele Patientinnen und Patienten sich das vorstellen. Beim Verfahren wird eine Probe der Cerebrospinalflüssigkeit entnommen, um im zentralen Nervensystem Entzündungszeichen zu analysieren. Heute werden dazu sehr feine Nadeln benutzt, die praktisch keine Schmerzen verursachen. Zudem bestehen bei dieser Untersuchung nur geringe Risiken.
Die Behandlung der Multiplen Sklerose: Schübe und Symptome
Gegenwärtig gibt es keine kurative Behandlung der Multiplen Sklerose. Medikamente ermöglichen jedoch, das Fortschreiten der Erkrankung besser zu kontrollieren und die Symptome zu lindern. Bei einem Schub werden oft Schubbehandlunen wie Infusionen oder Tabletten verschrieben, um die Erholung nach einem Schub zu beschleunigen. Diese Behandlungen wirken bei akuten Symptomen, sie haben jedoch keinen Einfluss auf die längerfristige Entwicklung der Erkrankung.
Die Verlaufsbehandlungen bezwecken hingegen ein langsameres Fortschreiten der MS, indem die Häufigkeit und die Intensität der Schübe reduziert werden. Gewisse Medikamente mit immunmodulierenden und/oder immunsupprimierenden Wirkmechanismen können entsprechend ihrer Wirksamkeit individuell eingesetzt werden. Dies geschieht unter Berücksichtigung der mit ihnen verbundenen Risiken und Auswirkungen auf die Lebensqualität. Diese Behandlungen helfen bei der Begrenzung der Verletzungen im zentralen Nervensystem und tragen so zur Verlangsamung der Weiterentwicklung der Erkrankung bei. Mit einer geeigneten Behandlung kann das Fortschreiten der Erkrankung vollständig gestoppt werden.
Gezieltere therapeutische Optionen im Entwicklungsstadium
Die aktuellen Behandlungen ermöglichen eine bessere Kontrolle der Erkrankung. Gegenwärtig werden jedoch auch neue, gezieltere Therapien mit einer verbesserten Wirksamkeit entwickelt, mit denen gleichzeitig die unerwünschten Wirkungen reduziert werden. Für ein besseres Verständnis der Ursachen der Erkrankung und zum Testen von neuen therapeutischen Ansätzen werden gegenwärtig ebenfalls zahlreiche Studien durchgeführt.
In Situationen, die immunsupprimierende Behandlungen erfordern, finden regelmässige Kontrollen statt, um die Infektionsrisiken zu begrenzen.
Eine globale und individuelle Behandlung
Die Behandlung der MS beschränkt sich nicht auf Medikamente. Sie umfasst ebenfalls einen personalisierten Ansatz, um die Lebensqualität der Patientin oder des Patienten zu verbessern. Regelmässige körperliche Aktivitäten spielen zum Beispiel eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der physischen und kognitiven Funktionen. Dabei ist es wichtig, dass die Patientinnen und Patienten die Intensität und die Häufigkeit ihrer Aktivitäten an ihren Gesundheitszustand anpassen, um die Ermüdungssymptome nicht zu verstärken.
Auch der Umgang mit der Müdigkeit ist entscheidend, da praktisch alle Patientinnen und Patienten mit MS davon betroffen sind. Erholungsphasen sind notwendig, um die Energie der Nerven- und Muskelzellen zu erhalten. Psychologische Unterstützung, die Anpassung der Arbeitsumgebung und das Stressmanagement sind ebenfalls wichtige Elemente der Behandlung.
Lebenserwartung und Lebensqualität
Obwohl Multiple Sklerose eine unheilbare Erkrankung ist, beeinträchtigt sie nicht unbedingt die Lebenserwartung. Dank der aktuellen Behandlungsmethoden bleibt die Mortalität in Zusammenhang mit MS im Verhältnis zum Schweregrad der Erkrankung gering. Chronische Symptome wie Gangunsicherheiten, fehlende Kraft, manchmal Störungen der Blasen- und Stuhlentleerung, Müdigkeit, Schmerzen und kognitive Störungen können jedoch die Lebensqualität beeinträchtigen. Es ist deshalb ausschlaggebend, dass die Patientinnen und Patienten von einer frühzeitigen und geeigneten Behandlung profitieren, um ihre Autonomie und ihr Wohlbefinden zu erhalten.
Ratschläge für Personen, bei denen vor Kurzem SM diagnostiziert wurde
Wenn bei Ihnen vor Kurzem Multiple Sklerose diagnostiziert wurde, ist es wichtig, dass Sie sich nicht entmutigen lassen. Besprechen Sie mit Ihrem Arzt die geeigneten therapeutischen Optionen für Ihre Situation. Mit einer regelmässigen ärztlichen Nachkontrolle kann die Entwicklung der Erkrankung verfolgt werden. So ist es auch möglich, die Behandlung an die Bedürfnisse anzupassen.
Wir empfehlen Ihnen ebenfalls, aktiv zu bleiben und regelmässig eine körperliche Aktivität auszuüben. Steigern Sie dabei schrittweise die Intensität und halten Sie die notwendigen Erholungsphasen ein. Zur besseren Verarbeitung der emotionalen Aspekte der Erkrankung kann auch die Betreuung durch eine Psychologin oder einen Psychologen sowie durch Unterstützungsgruppen sinnvoll sein. Je nach Symptomen wirkt manchmal auch eine regelmässige physiotherapeutische und/oder ergotherapeutische Behandlung unterstützend. Wenn sich Symptome wie Müdigkeit oder kognitive Störungen verschlimmern, wird zur Kontrolle ebenfalls eine neuropsychologische Bilanz empfohlen.