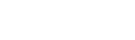Der Sinn für Zusammenarbeit ist einer der fünf Werte der strategischen Vision des Spital Wallis. Es verpflichtet sich damit zu einer kollaborativen Beziehungsdynamik, die mit den übrigen Fachpersonen, den Patienten und ihren Angehörigen abgesprochen ist, um die Übereinstimmung ihrer Handlungen mit einem kohärenten therapeutischen Behandlungspfad zu gewährleisten. Gespräch mit Eric Bonvin, Generaldirektor der Institution, über dieses Versprechen einer kollaborativen Arbeitskultur.
Was versteht man genau unter «kollaborativer Arbeitskultur»? Ist es nicht selbstverständlich, dass man den Patienten anhört?
Vorerst ist zu erwähnen, dass die kollaborative Arbeit eine Massnahme darstellt, mit der gleichzeitig die Qualität und Wirksamkeit der Behandlung für den Patienten, die Gesundheit am Arbeitsplatz für die Gesundheitsfachpersonen und die Wirtschaftlichkeit verbessert werden können, ohne bedeutende Investitionen tätigen zu müssen. Das ist also das Wunderrezept (lacht).
Im Ernst, wenn man von kollaborativer Arbeit spricht, geht es vorerst um die Partnerschaft zwischen Fachpersonen, allerdings unter Einbezug des Patienten. Dieser muss involviert werden, da nur er wirklich sagen kann, ob ihm eine Behandlung zusagt oder nicht. Man kann das nicht einfach mit einer Röntgenaufnahme überprüfen … Damit wird zwar die Wirkung auf die Erkrankung ersichtlich, aber der Einzige, der uns sagen kann, ob ihm das passt oder nicht, ist wirklich der Patient.
Eine Behandlung sagt dem Patienten zu, wenn er mit den vorgeschlagenen Behandlungen und seiner Erkrankung «zurechtkommt». Und «zurechtkommen» bedeutet, einverstanden sein, Linderung verspüren. Diese Elemente sind nicht messbar, da sie nur wahrgenommen, empfunden und gefühlt werden. Und nur der Patient kann sich dazu äussern. Wenn man diese Dimension vergisst, ist die Versorgung nicht wirksam.
Technisch gesehen kann eine Patientenversorgung perfekt sein. Man kann eine Krankheit reparieren. Aber wenn der Patient keine Linderung verspürt, wenn er sich mit dieser Versorgung nicht wohl fühlt, wird die Behandlung nicht wirksam sein.
Wir leben in einer Zeit, in der alles messbar sein muss. Ausserdem wird auch nur das bezahlt, was messbar ist. Wie kann man in einem solchen System eine vermehrte Zusammenarbeit fördern?
Es gibt zwei Missverständnisse, die man klären muss. Das erste betrifft die Qualität, die in unserer modernen Welt auf zwei Arten definiert wird. Vorerst ist da die traditionelle Definition, die besagt, dass die Qualität nicht messbar ist. Sie wird wahrgenommen und empfunden, kann jedoch nicht gemessen werden. Aber in der heutigen medizinischen Sprache geht es nicht um diese Definition.
Heute benutzt man eine andere Definition der Qualität, die aus der Industrie stammt. Und diese Definition besagt, dass Qualität das Kriterium oder das Mass eines gut hergestellten Produkts ist: «Ich nehme einen Gegenstand und schaue, ob er gut gemacht ist». Und an diese «Qualität» denkt man heute, wenn man von Labels oder anderen Qualitätskriterien spricht.
«Unter “Qualität” versteht der Patient die nicht messbare und subjektive Dimension. Die ihm gegenüberstehenden Fachpersonen jedoch sprechen immer von der gemessenen Qualität.»
Es besteht da also ein grosses Missverständnis. Wenn der Patient von Qualität spricht, meint er damit die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung, seine Empfindung, die Art, wie er diese Beziehung wahrnimmt … Wenn seine Erkrankung behandelt wird und er von «Qualität» sprechen hört, versteht er darunter die nicht messbare und subjektive Dimension. Die ihm gegenüberstehenden Fachpersonen jedoch sprechen immer von der gemessenen Qualität.
Diese beiden Vorstellungen sind nicht unvereinbar, aber sie müssen heute zusammengebracht werden: Es braucht die menschliche Qualität und die «industrielle» Qualität.
Und das zweite Missverständnis?
Es betrifft die Wirksamkeit. Wenn man von der Wirksamkeit einer Behandlung spricht, wird diese immer an der Erkrankung überprüft: Man nimmt den Zeugen einer Erkrankung, zum Beispiel Zellen, und man überprüft, ob eine medikamentöse oder eine andere Behandlung auf diese Zellen einwirkt. Es ist diese Wirksamkeit, von der man immer spricht. Aber dabei geht es nie um die Auswirkung auf die kranke Person. Oft heisst es: «Das ist ein Placeboeffekt», und die Angelegenheit ist erledigt. Und auch hier bin ich der Ansicht, dass die beiden Definitionen nicht unvereinbar sind. Sie müssen sich ergänzen. Es muss eine Wirkung auf die Erkrankung bestehen, aber es muss auch ein positiver Effekt der Linderung, also eine Auswirkung auf die kranke Person selbst, vorliegen. Man muss die beiden Definitionen zusammenbringen.
Man sollte also die Subjektivität des Patienten besser berücksichtigen …
Ja, denn die aktuelle Medizin macht zwar mit ihrem rationalen Vorgehen vieles möglich. Sie macht die Dinge verständlich, um auf sie einzuwirken. Man befindet sich hier im Reduktionismus und man teilt alles bis ins Detail auf. Die Dinge werden auseinandergenommen, um zu sehen, was sich im Inneren abspielt. Nehmen wir zum Beispiel die Strahlentherapie, die äusserst präzis auf die Zellen einwirkt. Das ist interessant. Aber dabei wird immer das Gesamte und der Träger der Erkrankung ausgeschlossen. Rationalismus und Reduktionismus schliessen definitionsgemäss den Zusammenhang und die Subjektivität des Patienten aus. Man muss den Rationalismus heute nicht über Bord werfen, aber ihn ausweiten. Deshalb bin ich der Ansicht, dass man eine Medizin mit Placeboeffekt anstreben muss.
Sie sagen, dass man «den Rationalismus ausweiten» muss. Auf welche Art und Weise?
Durch einen «kollaborativen» Ansatz, der den Patienten als Menschen und Partner einbezieht. Der Patient ist nicht nur Träger einer Krankheit, er ist auch derjenige, der die Krankheit spürt. Und wenn man den Patienten mit seinem Empfinden als kranke und behandelte Person in das Geschehen einbezieht, wird er auch seinen Teil zur Genesung beitragen. Sein wichtiger Anteil besteht darin, sich besser zu fühlen, etwas dafür zu tun, dass es ihm besser geht, und eben diese Wirksamkeit zu erzielen. Und das kann nur der Patient tun. Man muss ihn deshalb anhören, damit er als Teil der Behandlung dabei sein kann. Er kann nicht einfach sagen: «Hier bin ich und ich übergebe Ihnen meine Krankheit. Kommen Sie damit klar!»
«Die kollaborative Arbeitskultur schlägt den Wechsel von einem Wettbewerb, einem gegenseitigen Kampf, zu einer Dynamik der Zusammenarbeit mit dem Patienten vor.»
Wäre das für den Patienten nicht komfortabler? Sich auf die Spezialisten zu verlassen …
Es ist auf eine gewisse Weise komfortabler. Aber eines muss klar sein. Der Patient wird einverstanden sein, wenn er wirklich volles Vertrauen hat und überzeugt ist, dass sein Leiden gelindert wird. Es ist auf jeden Fall der Patient, der seine Versorgung bewilligt. Man kann niemanden gegen seinen Willen und ohne sein Wissen versorgen. Er muss also die Behandlung akzeptieren und sagen: «OK, ich vertraue Ihnen». Dieses Vertrauen ist sehr wichtig, da sich der Patient irgendwie «hingibt». Und dieses Vertrauen muss man gewinnen. Wenn man von Zusammenarbeit spricht, muss man also diese subjektive Dimension, das Empfinden des Patienten, seine Wesensart, integrieren …
Dabei scheint diese Zusammenarbeit manchmal zu fehlen …
Ja, diese Kultur der Zusammenarbeit ist nicht einfach umzusetzen, da unser System auf einer anderen Grundlage beruht. Es basiert auf der Konkurrenz und auf dem Wettbewerb. Heute befinden wir uns in einem Marktsystem, in dem man der Ansicht ist, dass auf der Grundlage des Wettbewerbs durch die Verbesserung der Qualität auch die Wirkung verbessert wird. Und das funktioniert nicht.
Weshalb funktioniert dieser Wettbewerb nicht?
Nehmen wir das Beispiel eines Operationstrakts: Wenn sich die Personen in einer Wettbewerbssituation befinden, werden sie nicht kommunizieren und auch keine wichtigen Informationen austauschen. Wenn es zwischen den Teams, die einen Patienten betreuen, zu Konflikten oder einem Wettbewerb kommt, werden gewisse Informationen verlorengehen. Der Patient weiss nicht, wo er sich befindet und seine Versorgung ist aufgeteilt. Der Wettbewerb ist Gift für unser System. Er verhindert die notwendige Transparenz und schadet der Patientensicherheit sowie der globalen Qualität der Versorgung. Das ist ein Problem, aber so sind die Grundlagen unserer Kultur, in der wir uns weiterentwickeln.
Die kollaborative Arbeitskultur schlägt vor, den Ansatz umzukehren. Sie schlägt den Wechsel von einem Wettbewerb, einem gegenseitigen Kampf, zu einer Dynamik der Zusammenarbeit mit dem Patienten vor.
Ist dieser Wettbewerb nicht vor allem auch ein Wettbewerb zwischen Teams und zwischen Institutionen?
Absolut, er kommt auf allen Ebenen vor. Ausserdem führt dieser Wettbewerb auf der Ebene der Institutionen zu einem Leistungsschutz. Heute wird geschätzt, dass einer von fünf Eingriffen und eine von fünf Leistungen unnötig sind. Man führt den Eingriff durch und erbringt die Leistung, weil man produktiv und wettbewerbsfähig sein muss. Da es sich aber um unnötige Eingriffe und Leistungen handelt, schaden sie dem Patienten. Wenn mir der Bauch ohne Grund aufgeschnitten wird, ist das nicht gerade fantastisch … Es handelt sich um ein riesiges Problem auf allen Ebenen.
Ein anderes Problem dieses Systems ist das schwierige Arbeitsklima. Die Mitarbeitenden beklagen oft einen Sinnverlust. Wenn man nur arbeitet, um «eine Leistung zu liefern» und wettbewerbsfähig zu bleiben, ist das schwer zu ertragen. Das führt vor allem zu einer ständigen Rivalität und zu einem Klima, das die Mitarbeitenden erschöpft. Damit haben wir heute ein richtiges Problem. Die Mitarbeitenden sind erschöpft.
Leiden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch unter dem Gefühl einer ständigen Kontrolle?
Ja. Man sah das zum Beispiel während der Covid-19-Pandemie, auch wenn man es bereits vorher wusste: Die Teams mit einem kollaborativen Ansatz hatten weniger das Gefühl der Erschöpfung als die Teams, in denen das Klima angespannter war und die sich unter Druck befanden.
Welche Möglichkeiten gibt es, um diese Veränderung in Richtung vermehrter Zusammenarbeit umzusetzen?
Es ist eine Veränderung, die nicht viel kostet und die allen zur Verfügung steht. Aber sie ist wahrscheinlich schwierig umzusetzen, da es sich um eine Frage der Kultur handelt. Das braucht also Zeit. Im Spital Wallis arbeiten wir bereits rund zehn Jahre daran. Allmählich sind Veränderungen festzustellen, aber wir müssen auf diesem Weg noch etwas weitergehen.
Das Spital Wallis kann aber auch nicht allein an diesem Kulturwechsel arbeiten …
Nein, diese Frage ist auch schon auf nationaler Ebene behandelt worden. Seit rund zehn Jahren rufen die Hochschulen und Universitäten zur Interprofessionalität auf. Die verschiedenen Berufe sollen lernen, zusammenzuarbeiten. Auch wenn das Ziel noch nicht erreicht ist, haben wir heute eine erste Generation von Studentinnen und Studenten, die für diese Interprofessionalität sensibilisiert worden sind.
«Eine Maschine kann etwas reparieren, aber sie kann keinem Patienten Linderung verschaffen. Dazu braucht es einen Menschen.»
Wir hoffen, und es ist vorgesehen, dass diese Studentinnen und Studenten die letzte Phase des Prozesses umsetzen, wenn sie ihre Berufskarriere in Angriff nehmen. Es handelt sich dabei um die kollaborative Dimension, die den Patienten einbezieht. Auf nationaler Ebene besteht das Ziel darin, die Fachpersonen für die notwendige Zusammenarbeit zu sensibilisieren, damit sie bereits zu Beginn ihrer klinischen Tätigkeit den Patienten als Partner integrieren.
Auch die Institutionen müssen an diesem Kulturwechsel arbeiten. Das Spital Wallis hat die Aufgabe, diese Gelegenheit zu nutzen und die verschiedenen Glieder der Kette zusammenzuführen. Ich bin überzeugt, dass dieser Ansatz für die Institution eine grosse Bedeutung hat. Deshalb haben wir den «Sinn für Zusammenarbeit» zu einem Kardinalwert des Spitals Wallis bestimmt.
Diese zunehmende Integration der Patienten wird im Spital Wallis, insbesondere über die Patientenverbände, allmählich sichtbar und fühlbar. Aber haben gewisse Berufe nicht das Gefühl, etwas an Macht zu verlieren, so wie es früher mit dem Dorfpfarrer, dem Lehrer und dem Gemeindepräsident der Fall war?
Ja, das ist richtig. Das waren Personen, die Wissen besassen und Macht hatten. Aber heute haben sie dieses Wissen nicht mehr. Das ist ebenfalls eine grosse Herausforderung. Man sagt nicht mehr: «Ich gehe zu einem Fachmann, weil er der Einzige ist, der weiss, wie es geht». Im Allgemeinen weiss man mehr als er. Und mit Chat GPT wird es noch schlimmer … Der Wert einer Fachperson besteht also nicht mehr ausschliesslich im Wissen.
Heute ist bei einer Begegnung mit einer Fachperson der menschliche Wert wichtig. Deshalb ist die menschliche Qualität, die menschliche Wirksamkeit massgebend. Alles andere kann von Maschinen übernommen werden. Eine Maschine kann also etwas reparieren, aber sie kann keinem Patienten Linderung verschaffen. Dazu braucht es einen Menschen. Und das ist es, was alle Gesundheitsfachpersonen, einschliesslich der Ärzte, tun können.
Es ist also im menschlichen Körper nicht alles so «mechanisch», wie man meinen könnte?
Das ist tatsächlich noch eine andere Art von Missverständnis. Seit dem XVI.-XVII. Jahrhundert ging man von der Idee aus, dass die Krankheiten die Ursache des menschlichen Leidens sind. Man war der Ansicht, dass mit dem Ausmerzen der Krankheiten, wie es das Projekt der WHO vorsieht, auch das Leiden verschwinden würde. Mit dem Ausdruck «Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit» lancierte man ein grosses Projekt zum Auslöschen der Krankheiten. Man sieht, dass das nicht unbedingt funktioniert … Abgesehen davon ist es richtig, sich mit den Krankheiten zu befassen und diesbezüglich macht die Medizin ihre Sache sehr gut. Aber sie erreicht jetzt ein eher kontraproduktives Stadium, in dem sie praktisch gleichviele Krankheiten produziert, wie sie versorgt.
Foto : © Sedrik Nemeth